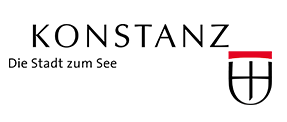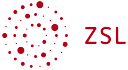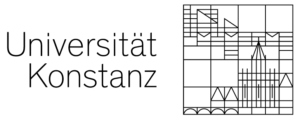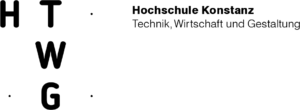Das Programm der Veranstaltung begann mit verschiedenen Grußworten von Prof. Dr. Katharina Holzinger, der Rektorin der Universität Konstanz, sowie von Petra Olschowski, der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg.
Der erste Vortrag „Wasser als Ressource und Gewässer als Lebensraum: Vom Nutzungskonflikt zur Lösung“ von Prof. Dr. Klement Trockner, beschäftigt sich mit globalen Umweltkrisen und wie diese, auch durch ihre Verknüpfung untereinander große globale Risiken in den nächsten Jahrzehnten darstellen werden. Besonders geht er auf den Klimawandel und den Biodiversitätsverlust ein.
Trockner kritisiert zum einen, die zunehmende Privatisierung der Forschung zu diesen Themen, zum anderen müsse aber auch mehr Geld in die Prävention dieser Umweltkrisen, und nicht nur in die Behebung von Umweltschäden, fließen. Besonders wichtig sei es, Flüsse zu schützen, die Biodiversität zu erhalten und Moore zu renaturieren. Neue Großprojekte sollen sich laut Trockner mehr auf hybride und naturbasierte Lösungen fokussieren. Er fordert schlussendlich, dass die Forschung, die Gesellschaft und die Politik gemeinsam an Lösungen forschen.
Der nächste Vortrag „Der See als verletzliches System – Funktionen, Services, Belastungen und Risiken“ von Prof. Dr. Karsten Rinke, thematisiert die Funktionsweise und Dynamik von Seeökosystemen, inwiefern diese für uns Menschen und die Umwelt von Bedeutung sind und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben.
Rinke teilt den Zuhörern mit, dass Seen leistungsfähige Ökosysteme, jedoch auch empfindlich gegenüber Nährstoffbelastung und Erwärmung sind. Des Weiteren seien deutsche Seen überwiegend in keinem guten Zustand. Sichtbar wird dies durch Sauerstoffverlust und „Algenblüten“ in den Seen, welche Zeichen der Degradation sind. Schlussendlich fordert Rinke mehr Investitionen in eine verminderte Nährstoffbelastung, sowie mehr wissensbasiertes Seenmanagement.
Anschließend folgte der Film „Das Forschungsschiff Robert Lauterborn“- ein mikroskopischer Blick auf den Bodensee“ von Prof. Dr. David Schleheck, welcher die Routineausfahrt des Schiffs zur Untersuchung des Planktons im Überlinger See begleitet. Schleheck erläutert im Film, wie die Proben entnommen und ausgewertet werden.
Der folgende Vortrag „Pestizide in Naturgewässern – Schädlich oder nicht?“ von Prof. Dr. Susanne Kühl thematisiert die Bedrohung von Amphibien durch Umweltgifte, insbesondere Pestizide wie Glyphosat. Kühl untersucht die Auswirkung des Pestizids auf die Embryonalentwicklung am Krallenfrosch. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Glyphosat als Reinstoff Entwicklungsstörungen bewirkt, die Genaktivität verringert und teilweise zum Tod von Embryonen führt. Diese Folgen treten alle bei Umweltkonzentrationen auf, wie sie in Naturgewässern gemessen wurden. Schlussendlich zeigt Kühl anhand des Beispiels von Mücken auf, dass Amphibiensterben auch für uns Menschen eine Rolle spielt. Ein Anstieg von Mückenpopulationen kann in bestimmten Regionen auch eine Zunahme von durch Mücken übertragbare Krankheiten, wie Malaria, zur Folge habe.
Auf diesen Vortrag folgte der Film „Quaggamuscheln- invasive Arten im Bodensee“ von PD Dr. Piet Spaak. Der Film zeigt das Projekt, welches die Auswirkungen des Klimawandels und invasiver Arten, wie der Quaggamuschel im Bodensee, untersucht. Diese invasive Art vermehrt sich stark, filtert Nährstoffe aus dem Wasser und stört das Ökosystem, wodurch Fische nicht mehr genug Nahrung haben. Da sich die Muscheln nicht entfernen lassen, fordert Spaak eine Bootreinigungspflicht, um ihre Ausbreitung von See zu See zu verhindern.
Der letzte Vortrag „Der Arktische Ozean im Wandel – von Überlebenskünstlern und solchen, die es werden wollen“, von Prof. Dr. Laura Epp, beschäftigt sich mit Veränderungen im arktischen Ozean im Zuge des Klimawandels. Zunächst berichtet Epp über die Bedeutung der Arktis als Lebensraum für Tiere und Bestandteil des globalen Klimasystems. Auch geht sie auf Besonderheiten in der Forschung ein, wie das Arbeiten im arktischen Winter ohne genügend Licht. Epp stellt ein Projekt vor, dass jedoch ganzjährig in Norwegen stattfindet. Dadurch sollen ökologische Reaktionen erfasst, zukünftige Entwicklungen absehbar und das Verständnis für den Wandel vertieft werden.