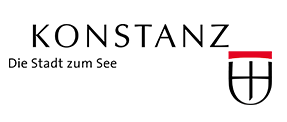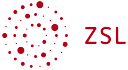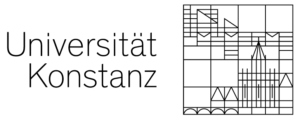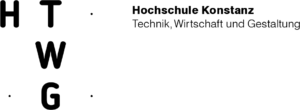Maria Reina Navarro Crespo, Sopran
Isora Castillo, Klavier
am Dienstag, den 10. Dezember 2024 um 18 Uhr in der Aula des Alexander-von-Humboldt Gymnasiums
PROGRAMM
H. Duparc, “L’invitation au voyage”
G. Fauré, “Les Roses d’Hispahan”
G. Bizet, “Les adieux de l’hôtesse arabe”
L. Delibes, “Les filles de Cadix”
F. Obradors, F. García Lorca, Canciones populares antiguas, “Las morillas de Jaén”
E. Granados, Goyescas, “La maja y el ruiseñor”.
M. de Falla, Siete canciones populares españolas
- El paño moruno
- Seguidilla murciana
- Asturiana
- Jota
- Nana
- Canción
- Polo
Orientalismus, Modernismus und das „spanische Wunder“
Am 10. Dezember um 18 Uhr fand der Vortrag des Hegau-Bodensee-Seminars zum Thema „Orientalismus, Modernismus und das ‚Spanische Wunder‘“ statt. Mit Maria Reina Navarro Crespo als Sopranistin und Gloria Revert Lázaro am Klavier wurde dem Publikum ein interessanter und interaktiver Abend geboten, der sowohl geschichtlich als auch künstlerisch geprägt war. Es wurden Stücke von Henri Duparc bis hin zu Georges Bizet vorgestellt, und auch Gemälde von Henri Matisse und Jean-Léon Gérôme wurden besprochen. Im Mittelpunkt des Vortrags stand die Musik des Orients und des spanischen Flamencos sowie die kulturellen Vorstellungen, die sich daraus entwickelt haben.
Zu Beginn des Vortrags erklärte Reina Crespo, wie wichtig es ist, in Kunstwerken das „Feuer“ zu finden, das den Künstler dazu brachte, sein Werk zu schaffen. Bei Henri Duparc war dies beispielsweise eine Art Trost, den er während des Deutsch-Französischen Krieges suchte. In seinem Lied „L’invitation au voyage“ ließ er sich von dem Gedicht „Les Fleurs du mal“ (Die Blumen des Schlechten) von Charles Baudelaire inspirieren. Der Text versucht, aus dem Schlechten das Schöne zu ziehen. Leider sind von seinen Werken nur noch wenige erhalten, da er diese aus Unzufriedenheit verbrannt hatte. Daraufhin spielten Reina und Gloria sein Lied zusammen.
Im Anschluss zeigten sie das Bild „Luxe, calme et volupté“ von Henri Matisse, der sich in seinen Werken von Baudelaire und Duparc inspirieren ließ. In diesem Bild zeigt er Ordnung und Schönheit, aber auch Luxus, Ruhe und Lust. Reina erklärte, dass Matisse in seinem Bild eine andere Sprache finden wollte, um die Ruhe des Bildes zu verstärken, indem er Pointillismus und Neo-Impressionismus verband. Duparc verwendete ebenfalls diese „andere Sprache“; er hingegen nutzte einen Dur- und Moll-Modus in den ersten Takten. Gloria spielte das Intro des Liedes „L’invitation au voyage“, und das Publikum sollte sich Gedanken darüber machen, an was sie die Melodie erinnert. Die Antworten aus dem Publikum deuteten auf Zweifel und Angst hin. Reina erklärte, dass dies durch die Reibung des Halbtons verursacht wurde, die ein gewisses Fernweh und die Lust auf neue Welten auslöst, aber auch Angst und Unruhe mit sich bringt. Der Ort, um den es in diesem Lied und Gemälde geht, ist Amsterdam. Da Amsterdam auch als das „Tor zum Osten“ bezeichnet wurde, war es praktisch eine Reise, ohne das Haus zu verlassen, da man die exotischen Produkte wie Seide und Gewürze hautnah erlebte. Doch es stellte sich die Frage: Was ist eigentlich der Osten, und was fällt uns dazu ein?
Auf oberflächlicher Ebene konnte man an andere Kleidung wie Turbane und Schleier denken, aber auch an die Gerüche exotischer Gewürze. Um jedoch zur tieferen Bedeutung zu gelangen, hörten wir uns zwei Stücke an, um den orientalischen Klang zu erfassen. Die Stücke waren „Les roses d’Isphan“ von Fauré und „Les Adieux de l’hôtesse arabe“ von Bizet. Im Stück von Fauré wird der idealisierte Ort im Iran als Poetik des Orients dargestellt, und man kann die Süße der Liebe zur orientalischen Schönheit, Leila, heraushören. Musikalisch klingt das Stück jedoch eher französisch und nicht besonders orientalisch. Das Lied von Bizet hingegen erinnert an Wüste, Palmen und Schönheit im Überfluss. Im Lied sind auch die männlichen Fantasien gegenüber orientalischen Frauen zu erkennen, die „auf Knien dienen und dir etwas vorsingen“. Musikalisch erinnert es an das literarische Werk „Tausendundeine Nacht“ sowie an andere orientalisch inspirierte Werke wie den Film „Aladdin“. Woher kommt jedoch dieser orientalische Klang, der uns allen bekannt ist? Dies beantwortete Reina, indem sie das Schema der doppelt harmonischen Dur-Tonleiter erklärte, die auch als Zigeunertonleiter bekannt ist. Dabei wird der zweite und der sechste Ton der Skala um einen Halbton erhöht. Um dies zu verdeutlichen, spielte Gloria die erste Linie der Melodie „Plusque rien ne t’arrête en cet heureux pays“. Diese Tonleiter vermittelt den Hörern das Gefühl, sich an einem Ort zu befinden, an dem Fantasien möglich sind.
Wenn man den geschichtlichen Zusammenhang genauer betrachtet, erkennt man, dass der Begriff des Orients auf einer überspitzten und überholten Sichtweise der Europäer basiert. Nachdem Napoleon 1801 Ägypten eroberte und 1830 auch Algerien einnahm, reisten viele Europäer in diese Länder. Zudem wurde viel orientalische Propaganda-Malerei betrieben, in der grausame und gesetzlose Menschen dargestellt wurden. Männer wurden als Barbaren bezeichnet, während Frauen als Odalisken und halbnackt in Harems gezeigt wurden. Die Franzosen hingegen spiegelten Ordnung und Vernunft in ihren Bildern wider. Dies wird gut erkennbar in „General Bonaparte with his Military Staff in Egypt“ von Jean-Léon Gérôme, in dem eine Gruppe französischer Soldaten gesittet auf Kamelen reitet, und im Bild „Le retour en majesté des Femmes d’Alger“ von Eugène Delacroix, das einen Harem mit aufreizenden Frauen zeigt. Die Bilder der Harems beruhen jedoch auf reiner Vorstellungskraft, da Europäern der Zutritt zu diesen nicht gewährleistet war. Sie malten, was sie gerne sehen würden: nackte Frauen. Es zeigt sich, dass das gesamte Bild des Orients auf vagen Vorstellungen aus Kunst und Literatur beruht und nicht vollständig der Wahrheit entspricht. Selbst der Begriff „Osten“ ist schwer zu fassen, da er je nach Standort auf der Weltkarte unterschiedlich interpretiert werden kann. Damit befasste sich Edward Said in den 70er Jahren in seinem Buch „Orientalismus“, in dem er darauf hinweist, dass alle, die sich vom Orient inspirieren ließen, zur künstlichen Trennung von Westen und Osten beigetragen haben. Die Folgen dieser Blockbildung sind Stereotype, die bis heute weit verbreitet sind. Um ein Beispiel für diese Stereotype zu zeigen, ließ Reina einen Teil des Musikvideos „Beautiful Liar“ von Beyoncé und Shakira sehen. Darin zeigen sich die beiden Sängerinnen als „sexy Frauen“ und tanzen erotisch zur Musik, wobei sie Handbewegungen machen, die an den Flamenco erinnern. Auch die zuvor genannte „Zigeunerskala“ ist wieder zu erkennen.
Nach einer 20-minütigen Pause ging der Vortrag weiter.
Das Ziel des Vortrags war es, die Zusammenhänge zwischen diesen drei Themen zu erläutern und deren Bedeutung für die Kultur und Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts zu analysieren. Im Rahmen der Präsentation ging Maria Crespo unter anderem auf das „spanische Wunder“, eine wichtige Zeit der spanischen Geschichte, ein. Diese Zeit, die rund um das 19. Jahrhundert stattfand, war geprägt von einer kulturellen Blüte, die sich in Kunst, Literatur und Musik widerspiegelte.
Der typische Stereotyp Spaniens ist der Stier, der Bolero, die Kastagnetten und die sinnliche, aber aufsässige Frau, im Gegensatz zur „arabischen Hôtesse“, die man ursprünglich kannte. Maria Crespo hatte zur Veranschaulichung einige Objekte dabei, die das Bild „Spaniens“ untermalen sollten: eine Chipsverpackung mit einem Stier und eine Dame, bekleidet mit einem Flamenco-Kleid, die in einer melancholischen Pose mit erhobenen Armen steht, während Herren im Hintergrund Gitarre spielen.
Ein weiterer Aspekt der spanischen Kultur ist die „Filles de Cadix“, eine folkloristische Darbietung, die die Lebensfreude und Emotionen der Menschen in Cadix widerspiegelt. Ein bekanntes Musikstück, das oft in diesem Zusammenhang gespielt wird, ist „El paño moruno“. In diesem sowie in vielen anderen spanischen Musikstücken ist das Wort „Ay“ ein Ausdruck von Emotion, oft Traurigkeit oder Sehnsucht, und verleiht den Texten eine besondere Tiefe. Dies ist zweifellos eines der charakteristischsten Merkmale des Flamencogesangs, das sich „ayeo“ nennt.
Ein weiterer Punkt, den Maria Crespo in ihrem Vortrag ansprach, war die Harmonielehre des Flamenco. Es gibt zwar viele verschiedene Arten des Flamenco, jedoch wurde während des Vortrags mehr auf das herkömmliche Flamenco eingegangen. Die Harmonielehre des Flamenco unterscheidet sich maßgeblich von der westlichen Musiktheorie. Als Beispiel veranschaulichte Gloria Lázaro verschiedene Akkordfolgen, um zu zeigen, die Jazzpianisten beneiden würden. Was in der klassischen europäischen Harmonielehre kompliziert ist, geht auf der Gitarre einfach durch Fingeranheben. Wirklich charakteristisch für Flamenco ist jedoch, was die Spanier „cadencia andaluza“ nennen. Diese klingt wie folgt:
Lam – SolM – FaM – MiM
(röm. 1 – röm. 7 – röm. 6 – röm. 5)
Das Außergewöhnliche an dieser Kadenz ist, dass sie die Halbkadenz zur Dominante durch den siebten und sechsten Grad verläuft. Das ist es, was den Flamenco-Sound ausmacht. Im Vortrag wurde oft betont, dass der Flamenco musikalisch sehr vielfältig aufgebaut ist. Er besteht aus Gesang, Gitarre und Tanz und hat oft einen improvisierten Charakter.
Auch ein Musikstück der spanischen Sängerin Rosalía war Teil der Präsentation von Maria Crespo und Gloria Lázaro. Rosalía studierte Flamenco in Barcelona. Ihr Abschlussprojekt war es, eine Geschichte aus einem okzitanischen Roman des 13. Jahrhunderts zu adaptieren, mit dem Titel „La flamenca“. Das Ergebnis war ihr Album „El mal querer“. Die Meinungen darüber sind jedoch gespalten.
Es wurde in dem Vortrag diskutiert, ob sie dem ursprünglichen Flamenco neues Leben einhaucht oder ihn zerstört. Viele Fans glauben, dass sie frische Elemente in die traditionelle Musik bringt, während Kritiker befürchten, dass die Essenz des Flamenco verloren geht. Maria Reina Crespo ist der Meinung, dass es zur Freiheit des Künstlers gehört, dass der Flamenco genau aus der Mischung der Kulturen hervorgegangen ist und sich stets weiterentwickelt hat. Ihre Schlussworte waren: „(…) erkundet, liebt und interpretiert neu. (…) Wichtig ist der Kontext und das Wissen (…), Kultur zu haben, um frei zu sein, sei es vor einer leeren Leinwand, einem leeren Notenblatt oder beim Hören einer Oper im Theater. (…) Nutzt die Gelegenheit, weiter zu wachsen und zu lernen, um immer frei zu sein.“