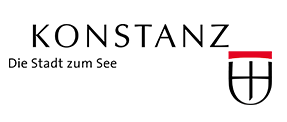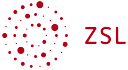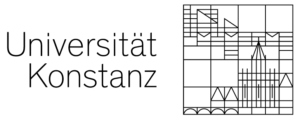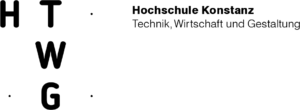Datum: 14.01.2025
Referentin: Dr. Katharina Palmberger
Thema: Kunstgeschichte und Archäologie im östlichen Mittelmeerraum
PROTOKOLL ZUM VORTRAG: BYZANZ UND DAS LEBEN ALS ARCHÄOLOGIN IN ISRAEL
Dr. Katharina Palmberger nahm uns mit auf eine Reise durch Kunst und Geschichte, aufgeteilt in zwei Schwerpunkte:
- Die kunsthistorische Betrachtung von Architektur und Kultur im byzantinischen Raum.
- Die Rolle der Kunst als kulturelle Brücke, insbesondere in ihrer archäologischen Arbeit in Israel und Jerusalem.
Ziel des Vortrags war es, ein tieferes Verständnis für architektonische Formen zu entwickeln und zu lernen, wie diese als historische Quellen dienen können. Dabei wurde bewusst auf politische Konflikte verzichtet und der Fokus auf die archäologischen Aspekte gelegt
1 Geografischer Kontext und Archäologische Methoden:
Dr. Palmberger begann mit einer geographischen Einordnung des östlichen Mittelmeerraums und der fruchtbaren Gebiete in der Region. Dabei wurde anhand einer Karte verdeutlicht, wie sich das Landschaftsbild zwischen Wüstenregionen und fruchtbaren Flächen unterscheidet. Besonders hervorgehoben wurde die Stadt Shivta in Israel, eine antike byzantinische Siedlung, die sich architektonisch stark an ihre Umgebung anpasst. Das Gebaute fügte sich so gut in die Landschaft ein, dass es aus der Ferne kaum erkennbar ist. Die klimatischen Bedingungen sind bis heute unverändert trocken, weshalb sich die folgende Frage stellen lässt: Wie überlebten die Menschen dort?
2 Archäologische Funde und Lebensweise:
Die archäologischen Untersuchungen zeigen, dass die Bewohner von Shivta trotz schwieriger Bedingungen in gewissem Wohlstand lebten. Archäologen erzielten nämlich Funde von getrocknetem Fisch aus dem Roten Meer sowie Marmorausstattungen in Kirchen. Die Finanzierung erfolgte durch Landwirtschaft. Durch den Bau von Flussbetten wurde Regenwasser gesammelt und für den Anbau von Pfirsichen und Trauben genutzt. Besonders bekannt war der dort produzierte süße weiße Wein, der bis nach Südfrankreich exportiert wurde. Wein wurde damals auch medizinisch genutzt, jedoch war die «heilende Wirkung» vermutlich eher Einbildung aufgrund der berauschenden Wirkung
3 Herausforderungen der Archäologie in Israel:
Ein Problem für Archäologen in Israel ist das Fehlen von DNA-Spuren menschlicher Überreste. Aufgrund der jüdischen Bestattungsvorschriften ist es nahezu unmöglich, die Auskunft der Menschen zu bestimmen, teilt uns die Referentin mit. Dies erschwert die Rekonstruktion der Bevölkerungsstruktur erheblich.
Zudem gibt es zwei verschiedene archäologische Methoden:
➢ «Schöne Archäologie»: Untersuchung von Kirchen, Moscheen und prachtvollen Bauwerken.
➢ «Mülleimer-Archäologie» Untersuchung von Abfällen, um Essgewohnheiten und Umweltbedingungen zu erforschen.
Im 6. Jahrhundert wurde Müll geordnet auf Hügeln deponiert. Zu beobachten war jedoch, dass in christlichen Gebieten der Abfall außerhalb der Stadt entsorgt wurde, während Muslime ihren Müll innerhalb der Wohnbereiche behielten.
4 Religiöse Bauwerke und ihr Wandel:
Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Zusammenleben von Christen und Muslimen. Die Architektur der Region zeigt, dass religiöse Gebilde häufig umgewandelt wurden. Während Kirchen nach Osten ausgerichtet (Sonnenaufgang) sind, orientieren sich die Moscheen nach Mekka. In Shivta befindet sich eine Moschee direkt neben einer Kirche, was darauf hinweist, dass Christen und Muslime friedlich zusammenlebten.
Die «erste islamische Prägung in Israel» begann im Jahr 623 n. Chr. Dokumente aus dieser Zeit sind oft zweisprachig in Arabisch und Griechisch verfasst.
5 Besondere Bauwerke in Jerusalem:
Einer der bedeutendsten Orte ist der Felsendom, dessen Baujahr auf 691/692 n. Chr. datiert wird. Das Architektonisch oktogonales Gebäude mit einer runden inneren Struktur, definiert das besondere Merkmal des Gebildes. Möglicherweise steht der Felsen im Zentrum auf einem ehemaligen jüdischen Brandaltar. Aufgrund der politischen Lage kann dort jedoch nicht gegraben werden. Der Felsendom wurde von frühchristlichen Gefügen wie der Grabeskirche inspiriert.
Ein weiteres Beispiel für bedeutende Bauwerke innerhalb Jerusalem ist das Goldene Tor, welches einer Theorie nach zugemauert wurde, um ungewollten Eintritt am “Jüngsten Tag” zu verhindern.
6 Bevölkerungsentwicklung:
Die Bevölkerung von Shivta veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte drastisch. In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts kam es zu einem Pestausbruch im Mittelmeerraum, der möglicherweise zu einer Bevölkerungsreduktion führte. Nach und nach zogen immer mehr Menschen aus der Stadt aus, was durch zugemauerte Häuser sichtbar ist. Der Niedergang von Shivta war jedoch hauptsächlich durch Erdbeben bedingt, die in der Region überwiegend für Zerstörung sorgten. Überragende Teile der Stadt waren daher im wesentlichen Begraben.
Der Vortrag von Dr. Palmberger bot eine weitreichende Einsicht in die archäologische Forschung im östlichen Mittelmeerraum. Besonders deutlich wurde die enge Verbindung zwischen Architektur, Kultur und Geschichte. Ebenfalls erfasste man den Fakt, wie Handelsbeziehungen und Umweltanpassungen das Leben in extremen Regionen ermöglichten. Die Kunst bildet eine Art kulturelle Brücke und funktioniert demnach unabhängig von Religion. Das Verständnis für historische Architektur und ihre Bedeutung wurde durch die anschaulichen Beispiele gefördert. Der Vortrag schloss mit der Erkenntnis, dass die Vergangenheit durch die Architektur der Gegenwart weiterlebt und interpretiert werden kann ab.